Das diesjährige Jahrestreffen der Kreisgemeinschaft Osterode/Ostpreussen, das in 2019 seinen neuen Veranstaltungsort in Lüneburg gefunden hat, hat die Erwartungen weit übertroffen: Die Teilnehmerzahl konnte knapp verdreifacht werden – die Festdiele des Gasthauses „Krone“ war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Lesen Sie hier die Begrüssungsansprache des Vorsitzenden Burghard Gieseler und einige Impressionen von der Veranstaltung:
‚Es ist ein warmer Tag im Frühsommer. Im Garten spielen die Kinder. Die Eltern sitzen auf der neuen Hollywood-Schaukel und genießen den frischen Bohnenkaffee. Ein alter Mann, der viel zu warm angezogen ist, nähert sich dem Grundstück. Er öffnet die Gartenpforte. Die Kinder laufen zu ihren Eltern und rufen: „Da ist ein fremder Mann!“ – und ahnen nicht, wer dieser Mann ist. Die Mutter jedoch ergreift eine Ahnung. Ihr Herz fängt an zu rasen. Vor ihr steht ihr seit neun Jahren vermisster Mann, den sie erst kürzlich für tot hatte erklären lassen.‘
Sie wissen, liebe Anwesende: solche Situationen hat es in der ersten Hälfte der 50er Jahre nicht selten gegeben. Sie wissen vielleicht aber nicht, dass es sie – wenngleich nur bei den Heimatvertriebenen – auch mit umgekehrter Rollenverteilung gab. Dann stand die Ehefrau, oftmals mit den ihr verbliebenen Kindern an der Hand, vor der Gartenpforte. Das konnte so sein, wenn der Ehemann und Familienvater in westalliierte Kriegsgefangenschaft gekommen und die Ehefrau mit den Kindern von der Front überrollt und, sofern sie dies überlebt hatte, von den Russen in ihren Heimatort zurückgeschickt worden war. Dort musste sie – besonders im nördlichen Ostpreußen – jahrelang den täglichen Kampf gegen den Hunger auf sich nehmen und war dabei der Gewalt und Willkür der neuen Herren schutzlos ausgeliefert, bis sie eines Tages ihre (inzwischen fremd gewordene) Heimat zu verlassen hatte. Währenddessen hatte sich ihr Ehemann, der aus relativ kurzer Kriegsgefangenschaft entlassen worden war, im Westen bereits ein neues Leben aufgebaut.
Solche und ähnliche Fälle dürfte es gerade auch unter den Flüchtlingen des Landkreises Osterode gegeben haben. Denn unser Landkreis lag genau im Zentrum des russischen Großangriffs und wurde in nur wenigen Tagen vollständig überrollt. Da es bekanntlich eine geordnete Evakuierung nicht gegeben hatte und die Trecks deshalb erst unmittelbar vor dem Eintreffen der sowjetischen Panzerspitze aufgebrochen waren, wurden sie in der Regel schon nach wenigen Kilometern eingeholt. Die meisten Trecks aus dem Landkreis Osterode schafften die Flucht nicht.
In den 60er Jahren, als ich ein Kind war, erzählte man sich noch gelegentlich von dem Mann an der Gartenpforte, der, als er nach Hause kam, seinen Platz von einem anderen eingenommen vorfand. Davon hatte ich gehört. Von dem umgekehrten Fall hingegen, von der Ehefrau (und Mutter), die nach langen Jahren der Trennung ihren Mann im Westen und den Platz an seiner Seite (ebenfalls) von einer anderen eingenommen vorfand, hatte ich noch nicht gehört. Dazu bedurfte es erst der Lektüre des Buches „Heimatlos“ unseres heutigen Referenten. Erst Ihr Buch, lieber Herr Dr. Spatz, hat mir das Schicksal dieser Frauen ins Bewusstsein gerufen, die nach einer schier endlosen Zeit der Entbehrung und der Rechtlosigkeit in den Westen kamen, um dort in manchen Fällen sogar zu erfahren, dass sie in der Zwischenzeit schuldig geschieden worden waren. „Die Ehemänner argumentierten häufig, dass ihre Frauen der Pflicht zur häuslichen Gemeinschaft jahrelang nicht nachgekommen seien und sich aus freiem Willen für einen Verbleib im Osten entschieden hätten“ (S. 45).
Wieder haben Sie, Herr Dr. Spatz, uns nach ihrem Buch über die ostpreußischen Hungerkinder das vergessene Schicksal einer ganzen Bevölkerungsgruppe in Erinnerung gerufen.
Ihr neuestes Buch „Heimatlos – Friedland und die langen Schatten von Flucht und Vertreibung“ ist alles andere als ein trockenes Sachbuch. Vielmehr besticht dieses Buch durch seine einzigartige Kombination aus wissenschaftlicher Solidität und Empathie gegenüber dem Schicksal der damaligen Menschen. Ihr Einfühlungsvermögen ist eine Charaktereigenschaft, die Sie als Mensch und, wie ich meine, als Historiker auszeichnet. Allerdings dürfte sich dieser Wesenszug durch Ihre bisherige Forschungstätigkeit, also durch unzählige Interviews mit Zeitzeugen, weiterentwickelt und verfeinert haben. Denn so wie Sie kann nur jemand schreiben, der sein Wissen nicht nur angelesen, sondern auch in persönlichen Begegnungen und Gesprächen mit den Betroffenen erworben hat.
Aber darf ein Historiker überhaupt Mitgefühl für das Leiden der Menschen haben, ohne die wissenschaftliche Distanz zu seinem Gegenstand zu verlieren? Ich meine: Ja. Er darf es. Er muss es sogar. Denn es wäre gar nicht möglich, das Leid ohne Empathie und Sympathie – also ohne Einfühlen und Mitfühlen – darzustellen und einer späteren Generation zu vermitteln. Einer solchen Darstellung fehlte die menschliche Dimension. Sie würde die Leser in ihrem Inneren nicht berühren.
Grundsätzlich ist jedes menschliche Leid es wert, dass man mit-leidet.
Dass sich dieser humanistische Anspruch und hohe wissenschaftliche Qualität keineswegs gegenseitig ausschließen, zeigt allein ein Blick auf das umfangreiche Literatur- und Quellenverzeichnis und auf die 156 Anmerkungen. Ihr Buch ist ungemein gründlich recherchiert, perspektivenreich, politisch ausgewogen, ohne unpolitisch zu sein.
Aber es ist, wie gesagt, die menschliche Tiefe, die Ihr Buch von anderen historischen Dokumentationen abhebt und es so unverwechselbar macht. Sie ergibt sich auch aus dem Zusammenwirken zweier Männer, die sich nicht einmal gekannt haben, zweier Männer, die in der Lage sind, hinter der verhärmten Miene eines Menschen seine verletzte Seele zu erahnen, – des Historikers Christopher Spatz und des Fotografen Fritz Paul. Der Text des Historikers und die Bilder des Fotografen ergänzen sich in einer geradezu idealen Weise, greifen ineinander und bilden eine Einheit. Wer den Text liest, kann nicht umhin, auch in den Gesichtern der Fotografien zu lesen – und ahnt vage, was die Menschen durchgemacht haben müssen. Dann wiederum lohnt es sich zu lesen, wie Dr. Spatz das jeweilige Foto kommentiert:
Unter einem Foto, auf dem ein Mann mit drei kleinen Jungen spricht, steht:
„Im Gespräch mit Erwachsenen sind die Kinder hellwach und aufmerksam. Aber ein Lächeln huscht ihnen kaum einmal über ihr Gesicht. Skepsis und genaues Beobachten haben ihnen in den zurückliegenden Jahren ihr Überleben gesichert.“
Und unter einem Foto, auf dem vor einer Baracke wartende Kinder zu sehen sind, steht:
„Vorzeitig gereift und von vielen Entbehrungen geprägt, wirkten anhanglose Kinder oft wie kleine Erwachsene, denen das Urvertrauen verloren gegangen war. Nach der langen Zeit ohne Familie können sie sich teilweise nicht einmal mehr an ihre Mütter erinnern, und wollen es in Friedland doch kaum abwarten, diese in Kürze endlich kennenzulernen.“
Aber, sehr verehrte Damen und Herren, erlauben Sie mir an dieser Stelle einmal grundsätzlich die Frage zu stellen, welchen Sinn es überhaupt hat, sich mit dem Leid der damaligen Menschen zu befassen. Wäre es nicht besser, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen und den Blick in die Zukunft zu richten? Nein. Es ist – davon bin ich fest überzeugt – nicht möglich, die Zukunft zu gestalten, ohne sich der Vergangenheit, und zwar der ganzen Vergangenheit zu stellen. Denn nur wenn wir bereit sind, uns unvoreingenommen für die ganze Geschichte zu öffnen, sehen wir das Leid auf allen Seiten, empfinden wir Empathie und Sympathie für alle Menschen – unabhängig von ihrer Nationalität. Nur dann entfaltet der Umgang mit der Geschichte seine friedensstiftende Wirkung zwischen den Völkern.
Aus diesem Geschichtsverständnis heraus haben wir in den vergangenen Jahren Freya Klier und Arno Surminski und in diesem Jahr Christopher Spatz zu uns eingeladen.
Auf diesem Geschichtsverständnis beruht unsere gesamte Erinnerungs- und Kulturarbeit, die wir deshalb als unseren Beitrag zu Versöhnung und Frieden verstehen. Dabei ist das unvoreingenommene Erinnern nicht nur eine Voraussetzung für den äußeren Frieden zwischen den Völkern, sondern auch für den inneren Frieden innerhalb eines Volkes. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hängen untrennbar miteinander zusammen. Ein Volk kann keinen Frieden finden, wenn es Teile seiner Geschichte und Kultur – und damit seiner Identität – verschweigt. Deshalb hängt die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft wesentlich von ihrem Umgang mit der Geschichte ab.
Das Erinnern muss sich, wie gesagt, auf die ganze Geschichte richten und diese besteht selbstverständlich nicht nur aus Leid. Natürlich haben sich unsere Vorfahren in den Jahrhunderten bis zu jener Schreckenszeit am und nach dem Ende des Krieges ihres Lebens genau so erfreut wie Menschen andernorts auch. Sie haben gelebt, geliebt und geweint, haben große Kulturgüter geschaffen, regionale Bräuche und einen unverwechselbaren Dialekt entwickelt, die Landschaft gestaltet, Städte und Dörfer gebaut – und ihnen Namen gegeben. An all das wollen wir, soweit wir es vermögen, erinnern.
Allerdings registrieren wir seit geraumer Zeit, dass es in Deutschland durchaus die Tendenz gibt, Teile der deutschen Geschichte und Kultur zu verschweigen: nämlich die Geschichte und Kultur der früheren deutschen Ostgebiete. So werden vielfach nur noch die polnischen Namen für die früheren deutschen Orte verwendet, so dass die alten Ortsbezeichnungen in Vergessenheit zu geraten drohen. Dieser Sprachgebrauch mag daher rühren, dass die Polen in der kommunistischen Zeit – und auch noch einige Jahre danach – die Verwendung der polnischen Ortsnamen verlangten. Das hat sich aber grundlegend geändert. Inzwischen haben unsere polnischen Partner die deutsche Geschichte und Kultur Ostpreußens als die Geschichte und Kultur des Landes angenommen, das heute ihnen gehört. Und sie pflegen sie gemeinsam mit uns.
Die grundsätzliche Verwendung der polnischen Ortsnamen ist aber nicht nur der früheren Erwartung Polens geschuldet, sondern auch – wie ich eben bereits angedeutet habe – einer allgemeinen Tendenz, die Geschichte, ja die Existenz der früheren Ostgebiete zu verschweigen. Auch im Schulunterricht werden diese nicht eigens thematisiert und so überrascht es nicht – wie ich bei meinem letzten Arbeitsbesuch in Osterode hörte -, dass Schülergruppen aus Deutschland regelmäßig aus allen Wolken fallen, wenn sie hören, dass Osterode bis 1945 eine deutsche Stadt war und dass die Namensähnlichkeit zwischen Ostróda und Osterode am Harz keineswegs zufällig ist.
Sehr verehrte Anwesende, ich nenne Ihnen ein weiteres Beispiel, das die Tendenz belegt, die Existenz der früheren deutschen Ostgebiete zu verschweigen: Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass in den zahlreichen historischen Dokumentationen, die im Fernsehen zu sehen sind, regelmäßig die heutigen Grenzen Deutschlands gezeigt werden, auch wenn sich die jeweilige Dokumentation auf eine Zeit vor 1945 bezieht. Damit wird der Eindruck erweckt, dass die Grenzen von heute schon damals existiert hätten – als ob es die deutschen Ostgebiete niemals gegeben hätte. Dies ist eine grobe Geschichtsfälschung, der wir uns mit aller Entschiedenheit entgegenstellen.
Heute gehört Ostpreußen zu anderen Ländern. Ein deutsches Ostpreußen wird es nicht mehr geben. Nie wieder sollen Menschen dazu gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen. Nie wieder dürfen Grenzen in Europa verschoben werden. Das ist unsere Haltung.
Gleichzeitig erinnern wir aber an das reiche historische Erbe Ostpreußens und wenden uns gegen jede Tendenz, die darauf hinausläuft, dieses historische Erbe zu verschweigen. Dabei ist es ja, wie ich schon sagte, gar nicht möglich, sich seiner Geschichte zu entledigen. Die Gegenwart hat sich aus der Vergangenheit entwickelt. Sie ist gleichsam das Ergebnis der Vergangenheit, die uns bis zum heutigen Tag prägt und die wir stets in uns tragen. Die Vergangenheit aber ist abgeschlossen und steht fest. Sie lässt sich rückwirkend nicht mehr ändern oder gar leugnen, ohne dass wir unseren inneren Frieden verlieren würden. Ebenso ist die Geschichte Ostpreußens ein unveränderbarer und unleugbarer Teil der Geschichte Deutschlands und natürlich auch Europas! Damit gehört sie dauerhaft zur deutschen und europäischen Identität.
Glücklicherweise gibt es zu jeder gesellschaftlichen Tendenz eine Gegentendenz. So freuen wir uns darüber, dass sich die Enkel der Erlebnisgeneration zunehmend für ihre Herkunft interessieren. Diese erfreuliche Entwicklung zeigt sich in den zahlreichen Anfragen, die uns von dieser Altersgruppe erreichen. Sollte es gelingen, bei dieser Generation ein über die eigene Familiengeschichte hinausgehendes allgemeines Interesse an dem Land der Vorfahren zu wecken, wäre mir um die Zukunft der Kreisgemeinschaften und der Landsmannschaft insgesamt gar nicht bange. Denn hier schlummert riesiges Potential.
Dass es gegenüber dem Thema „Ostpreußen“ auch ein wachsendes Wohlwollen gibt, zeigt eindrucksvoll die großartige Entwicklung, die das Ostpreußische Landesmuseum hier in Lüneburg genommen hat. Denn dieses Museum wird – und das war ja nicht immer so – inzwischen über alle Parteigrenzen hinweg geschätzt. Die Lüneburger haben das Ostpreußische Landesmuseum als ihr Museum angenommen. Das hohe Ansehen, das das Museum heute regional und überregional genießt, verdankt es in erster Linie der klugen Leitung seines Direktors, Dr. Mähnert.
Von der hohen Qualität der neuen Dauerausstellung haben wir uns heute Vormittag alle überzeugen können. Darüber hinaus freuen wir uns besonders darüber, dass noch ein weiterer Bauabschnitt geplant ist, in dem an Immanuel Kant, den bedeutendsten Philosophen der deutschen und europäischen Aufklärung, der Ostpreußen bekanntlich nie verlassen hat, erinnert werden soll. Kein anderer, meine Damen und Herren, verdeutlicht die nationale und internationale Dimension des kulturellen Erbes Ostpreußens so überzeugend wie Immanuel Kant.
Ostpreußen als politisches Gebilde gibt es nicht mehr. Sein historisches und kulturelles Erbe aber ist – wie das Beispiel Immanuel Kants zeigt – quicklebendig und wird auch in Zukunft dauerhaft Teil der deutschen und europäischen Identität sein.
Ebenso gibt es noch Ostpreußen als eine von Deutschen geprägte Kulturlandschaft. Auch in Zukunft wird es das „Land der dunklen Wälder und kristall’nen Seen“ geben.
Denn Ostpreußen ist nicht sterblich.
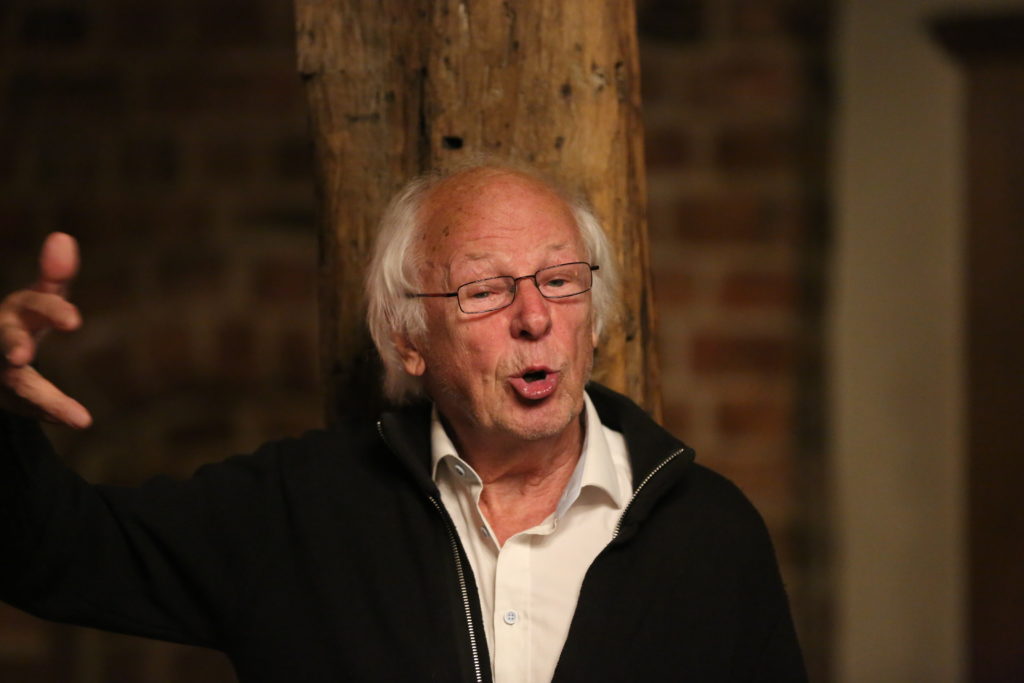
Der Schauspieler Herbert Tennigkeit bei dem Begrüßungsabend am 13. September. 
Ihm lauschen amüsiert Zuhörerinnen aus Osterode Ostpreußen. 
Der Schauspieler und seine jugendlichen Fans aus Ostpreußen. 
Während der Feierstunde in der vollbesetzten Festdiele der „Krone“ hielt Dr. Christopher Spatz den Vortrag „Heimatlos. Das Lager Friedland – ein ostpreußischer Schicksalsort in Niedersachsen“ 
Während der Feierstunde am 14. September erhielt Heinrich Hoch von der Kreisgemeinschaft aus Dankbarkeit ein Gemälde von dem wieder aufgebauten Rathaus in Osterode. Heinrich Hoch war der Initiator des Wiederaufbaues.
